|
Als
Bestandteil des jagdlichen Brauchtums dienen die
Bruchzeichen
im Rahmen der
Jagdausübung der Verständigung, der Markierung oder
der
Ausschmückung. Die Bruchzeichen haben ihren Ursprung allerdings in dem
Bedürfnis der Jäger, sich gegenseitig unauffällig, ohne dass es
Unberufene merken, zu verständigen. Für ein Bruchzeichen werden ausschließlich die
sogenannten "gerechten" Holzarten Eiche, Erle, Kiefer, Fichte
und
Tanne verwendet. Nur im Hochgebirge dienen Lärche, Latsche und
Alpenrose zur Anfertigung eines Bruches. Auch
die Bruchzeichen wurden früher regional unterschiedlich verwendet und
erst im Jahre 1934 vereinheitlicht. Die Brüche werden gebrochen,
nicht geschnitten; nur in einigen Fällen wird die Rinde teilweise
mit dem Waidmesser entfernt oder der Bruch gespitzt.
Es ist zu vermerken, dass nach heutiger Auffassung
selbstverständlich Zweige aller am Erlegungsort greifbarer Bäume oder
Sträucher als bruchgerecht gelten. Ein Jäger wird allerdings erst dann von
den bruchgerechten Baumarten abweichen, wenn diese erst mühsam gesucht
werden müssen. Wer zum Beispiel einen Rehbock in einem Weizenschlag
erlegt, kann ihn auch mit Ähren gerecht verbrechen. Das symbolische und
waidgerechte Handeln ist hier höherwertiger als das Verwenden der
gerechten Baumarten.
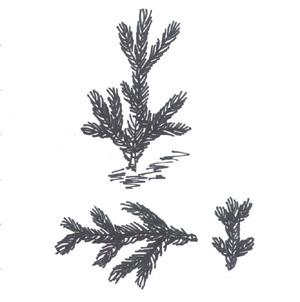
Anschussbruch |

Hauptbruch
|
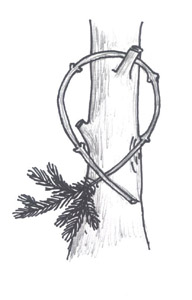
Warnbruch |
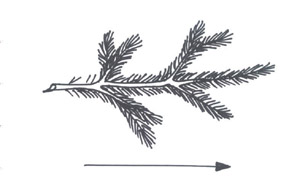
Leitbruch |
Übersicht der Bruchzeichen
Hauptbruch:
Der Hauptbruch sollte mindestens
Armlang sein. Um ihn auffälliger zu machen wird dieser Bruch
mit dem Waidmesser blank befegt (Rinde wird abgeschabt). Er
hat die Bedeutung “Achtung” und soll dem Jäger sagen er soll
auf weitere Zeichen achten. Auch kann er auffällig in
Augenhöhe aufgehängt werden. Ein Hauptbruch wird mit anderen
Brüchen in Kombination gelegt die den Jäger weiter führen. |
Leitbruch:
Der Leitbruch hat nur noch eine
halbe Armlänge aber ist ebenso befegt wie der Hauptbruch.
Die Rinde zwischen den Nadeln oder Blättern wird entfernt.
Sein gewachsenes Ende zeigt in der Richtung, in die es den
Jäger weisen soll. Die Leitbrüche werden so ausgelegt, das
man immer den nächsten Bruch sehen kann. |
Anschussbruch:
Der Anschussbruch ist ein Zweig
der unbearbeitet ist und senkrecht in den Boden gesteckt
wird. Es soll die Stelle markiert werden an dem der Jäger
das Stück Wild angeschossen hat. So kann diese stelle
schnell für Jäger und Hundeführer wiedergefunden werden.
Ebenso kann er nicht von Sturm, Regen oder Schnee bedeckt
werden. Oftmals wird dieser Bruch in Kombination mit anderen
Brüchen gelegt wie z.B. der Fährtenbruch um die
Fluchtrichtung des Stück zu markieren. |
Standortbruch:
Der Standortbruch ist auch
bekannt als Standplatzbruch. Hier durch kann einem Jäger
z.B. bei einer Gesellschaftsjagd ein Standplatz im
Jagdrevier zugeteilt werden. Hierzu wird ein armlanger Bruch
in der Erde gesteckt. Die Seitentriebe werden entfernt wobei
die Spitze jedoch bestehen bleibt. Dazu wird meistens ein
Leit- oder Hauptbruch gelegt, der dem Jäger nach Ablasen der
Jagd zum Sammelplatz führen soll. |
Wartebruch:
Bei dem Wartebruch werden zwei
unbefegte Brüche Kreuzweise übereinandere gelegt. Dies soll
ein Sammelplatz oder auch Warteplatz für den Jäger
darstellen. |
Warten aufgegeben:
Wurde vergeblich gewartet, werden
die Seitenzweige abgebrochen und der “kahle” Wartebruch
wird hingelegt. Bedeutung: habe das Warten aufgegeben. |
Hauptbruch:
Bei Gesellschaftsjagten wird
der Sammelplatz mit drei etwa 1 Meter langen gefegten und
in Pyramidenform zusammen gestellten Brüchen gekennzeichnet |
Sammelplatzbruch:
Der Fährtenbruch wird dort
benutzt wo der Schütze nicht bei der Nachsuche bei sein
kann. Es wird versucht so viele Informationen wie möglich
dem Nachsuchenführer zu übergeben. Dazu wird ein
unbearbeiteter halb-armlanger Bruch meist zu dem
Anschussbruch gelegt. Die gewachsene Spitze zeigt in der
Richtung, wohin das weiblich Stück abgesprungen ist.
Andersherum ist es bei männlichen Wild. Hier zeigt die
Bruchstelle in der Fluchtrichtung. Damit keine
Missverständnisse entstehen, wird zu dem Bruch noch ein
Geäfter (kleiner Querbruch) gelegt. Dies bedeutet nun das an
der gegenüberliegenden Stelle des Querbruchs die Richtung
und das Geschlecht markiert wird. |
Warnbruchbruch:
Für dem Warnbruch wird ein Bruch
komplett von seinen Seitentrieben befreit und zu einem Kreis
gebogen aufgehängt. Dies soll dem Jäger vor eine mögliche
Gefahr warnen wie z.B. eine Falle, unsicherer Hochsitz etc. |
Inbesitznahmebruch:
Der Inbesitznahmebruch oder auch
Aneignungsbruch genannt. Hierzu wird ein Zweig auf der Ein-
oder Ausschussstelle gelegt der die Stelle bedecken soll.
Der Bruch ist etwa halb-armlang und unbearbeitet. Für diesen
Bruch gilt die Regel: Bei einem männlichen Stück zeigt die
gebrochene Seite zum Haupt (Kopf) und bei einem weiblichen
die gewachsene Seite. Das erlegte Wild wird auf die rechte
Seite gelegt. |
Der letzte Bissen:
Der letzte Bissen ist ein
unbearbeiteter Zweig, der dem erlegten Wild quer in den Äser
(Maul) gelegt wird. Dies symbolisiert die letzte Mahlzeit
vor dem Tod. Der Brauch des Letzten Bissens, ein Bruch in
den Äser bzw. Gebrech bei männlichen Tieren, geht auf die
Frühzeit zurück und bedeutet soviel wie die Versöhnung mit
dem erlegten Tier und der Natur. Ursprünglich wurde der
Letzte Bissen nur dem männlichen Schalenwild gegeben.
Mittlerweile ist er aber oft auch bei weiblichem Wild und
auch beim Birkwild, sowie beim Murmeltier zu sehen. Der
Jäger hat das Wild in Besitz genommen und zeigt damit an,
dass das Stück rechtmäßig erlegt ist. Der Letzte Bissen ist
eine Form der Respektbezeugung gegenüber dem gestreckten
Wild. |
Schützenbruch:
Der Schützenbruch ist wohl einer
der Brüche, die neben dem letzten Bissen noch am meisten
angewandt werden. Hierzu wird ein unbearbeiteter Zweig mit
Schweiß (Blut) benetzt und mit der Oberseite der Blätter
oder Nadel an die rechte Seite des Schützenhut gesteckt.
Dies zeigt den anderen Jägern das jemand Jagderfolg hatte.
Ist der Jäger alleine bricht er selber den Bruch. Sind
jedoch im Rahmen von Gesellschaftsjagden oder anderer
Jagdarten mehrere Jäger anwesend, wird der Bruch durch eine
zweite Person über dem Hut oder einem Waidblatt mit einem
kräftigen “Waidmannsheil” und Händedruck übergeben. Trägt
der Schütze keinen tödlichen Schuss an so wird der Bruch vom
Nachsuchenführer übergeben, wobei Schütze dann seinen Bruch
teilt und dem Hund ein Teil an die Halsung (Halsband)
steckt. |
Festtagsbruch:
Der Festtagsbruch ist ähnlich dem
Schützenbruch, wobei er nicht mit Schweiß (Blut) benetzt
wird. Er wird bei festlichen zusammenkünften von Jägern
getragen. |
Trauerbruch:
Der Trauerbruch ähnelt dem
Schützenbruch. Der unbenetzte Bruch wird an der linken
Hutseite mit den Blättern oder Nadeln nach innen hin
getragen. Bei einer Beerdigung eines Jagdkameraden wird der
Hut vor dem Grab abgenommen und der Trauerbruch ins offene
Grab geworfen. |
Das letzte Bett:
Am Sammelplatz der Jäger wird die
gemeinsam gemachte Beute (Strecke) auf ein Bett von Brüchen
gelegt. Häufig sieht man bei größeren Strecken auch nur eine
Umrandung mit Brüchen. Dazu werden an den ecken Fackeln
aufgestellt. |
Selbstverständlich
gibt es noch weitere Bruchzeichen, die hier jedoch nicht erschöpfend
dargestellt werden.
zurück
|